
Wechseljahre und Depression: Warum die Menopause die Psyche belastet
Die Wechseljahre bringen nicht nur körperliche Veränderungen mit sich – sie können auch erhebliche Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben. Während Hitzewallungen und Schlafstörungen als typische Menopause-Symptome bekannt sind, wird der Zusammenhang zwischen hormonellen Veränderungen und dem Auftreten von Depression oder Angststörungen oft übersehen.
Inhaltsverzeichnis
ToggleDas Wichtigste kurz zusammengefasst:
- Depression und Angststörungen können in den Wechseljahren gehäuft auftreten.
- Jede menstruierende Person kann betroffen sein, auch ohne vorherige psychische Erkrankungen.
- Neben hormonellen Veränderungen können auch psychosoziale Belastungen in dieser besonderen Lebensphase Einfluss auf das psychische Wohlbefinden haben.
- Eine frühzeitige, individuell angepasste Behandlung ist entscheidend.
- Selbsthilfe-Strategien und Online-Therapieprogrammen unterstützen den Heilungsprozess.
Was bedeuten Wechseljahre, Menopause und Co. eigentlich?
Im Sprachgebrauch werden verschiedene Begriffe oft synonym verwendet, obwohl sie unterschiedliche Phasen beschreiben. Die Menopause ist medizinisch gesehen ein einziger Zeitpunkt: die allerletzte natürliche Menstruation im Leben einer menstruierenden Person. Da man dies jedoch erst im Nachhinein mit Sicherheit sagen kann, nämlich nach einem Jahr ohne weitere Blutung, wird die Menopause oft rückblickend festgestellt.
Die Zeit vor und kurz nach diesem Ereignis heißt Perimenopause – eine Phase, in der die Hormonspiegel bereits schwanken und erste Symptome auftreten können. Prämenopause ist die Zeit vor der Perimenopause, in welcher sich erste hormonelle Schwankungen meist um das 40. Lebensjahr herum zeigen, die jedoch so subtil sind, dass sie oft nicht wahrgenommen werden. Ein Jahr nach der letzten Blutung beginnt dann die Postmenopause, in der sich der Körper an das neue hormonelle Gleichgewicht anpassen muss.
Der Begriff Wechseljahre umfasst hingegen den gesamten Übergang, ähnlich wie die Pubertät eine längere Entwicklungsphase beschreibt. Er kann sowohl die Zeit der hormonellen Umstellung als auch die Jahre danach umfassen. Viele Frauen erleben ihre Menopause zwischen 50 und 55 Jahren, und nicht selten tritt die Menopause vor dem 50. Lebensjahr oder sogar vor dem 40. Lebensjahr ein. Faktoren wie Rauchen, Ernährung, Diabetes oder andere chronische Erkrankungen können den Zeitpunkt nach vorn verschieben, und oft ähnelt das Menopause-Alter dem der eigenen Mutter.1
Warum entstehen psychische Beschwerden in den Wechseljahren?
Die Wechseljahre sind weit mehr als nur das Ende der Menstruation. Sie markieren eine fundamentale hormonelle Umstellung: Die Produktion von Östrogen und Progesteron, aber auch vom Sexualhormon Testosteron nimmt kontinuierlich ab – jedoch nicht linear, sondern in einem jahrelangen Prozess, der starken Schwankungen unterliegen kann, bis sich irgendwann ein neues hormonelles Gleichgewicht eingestellt hat.
Diese hormonellen Berg- und Talfahrten belasten den gesamten Organismus. So gerät durch die Hormonschwankungen unter anderem das vegetative Nervensystem aus dem Gleichgewicht. Die Dysbalance führt zu den charakteristischsten und häufigsten Symptomen der Wechseljahre wie nächtlichen Hitzewallungen mit Schlafstörungen, Schweißausbrüchen, Herzrasen und Schwindel.
Neben Veränderungen des Nervensystems wird weiterhin ein Effekt des sich verändernden Östrogenspiegels auf andere Botenstoffe im Nervensystem vermutet. Insbesondere Serotonin scheint betroffen, welchem u.a. die Regulierung von Stimmung, Appetit, Schlaf-Wach-Rhythmus und Schmerzempfinden zugesprochen wird. Daneben wird angenommen, dass der Neurotransmitter GABA (Gamma-Amino-Buttersäure) beeinflusst wird, welcher für Entspannung und Beruhigungsprozesse relevant ist.2
Depression in den Wechseljahren: Was die Forschung zeigt
Verschiedene Studien belegen, dass hormonelle Veränderungen in den Wechseljahren das Risiko für depressive Symptome erhöhen können. Insbesondere die Übergangsphase zur Menopause stellt eine sensible Phase für die psychische Gesundheit dar.
Menstruierende Personen in der Menopause-Transition sind sowohl für neue als auch bestehende psychische Erkrankungen besonders anfällig. Eine wichtige Rolle kommt den Gynäkologinnen zu, die diese Veränderungen erkennen und adäquat behandeln sollten, um die Versorgung und Lebensqualität in dieser Lebensphase zu verbessern.3
Eine Langzeitstudie aus dem Jahr 2006 konnte belegen, dass menstruierende Personen im Übergang zur Menopause, also während der Perimenopause, ein mehr als vierfach erhöhtes Risiko für erhöhte Depressionswerte im Vergleich zur prämenopausalen Phase haben. Während der Menopause kann der hormonelle Umbruch wesentlich dazu beitragen, dass erstmals depressive Beschwerden entstehen.4
In einer Metaanalyse von 22 Studien zeigte sich zudem, dass Depression und Angststörungen während der Menopause und Postmenopause häufig auftreten. Ein erhöhtes Risiko besteht insbesondere bei vasomotorischen Beschwerden (z. B. Hitzewallungen) sowie bei menstruierenden Personen mit einer Vorgeschichte schwerer Depressionen. Auch psychosoziale Belastungen können das Depressionsrisiko in dieser Lebensphase verstärken.5 Beispielsweise belastet hier oft der Auszug der nun volljährigen Kinder oder aber eine Erkrankung und die Pflege der eigenen Eltern.
Aktuelle Forschung zeigt weitere psychische Auswirkungen der Menopause, die lange Zeit unterschätzt wurden. Viele Frauen berichten von einem veränderten Schmerzempfinden6 und erhöhter Reizbarkeit im Alltag. Besonders belastend können Konzentrationsschwierigkeiten und Gedächtnisprobleme sein, die oft als „Gehirnnebel“ (engl.: „Brain fog“) beschrieben werden und sowohl beruflich als auch privat zu Verunsicherung führen können.7
Wer ist besonders gefährdet?
Nicht jede Frau entwickelt während der Wechseljahre psychische Beschwerden. Das individuelle Risiko hängt von verschiedenen Faktoren ab:
Das individuelle Risiko wird stark von der genetischen Veranlagung für Depressionen beeinflusst. Frauen, die bereits in der Vergangenheit hormonbedingte Stimmungsschwankungen erlebt haben, etwa prämenstruelle Beschwerden, sind häufiger betroffen. Auch die Art der hormonellen Veränderung spielt eine Rolle: Bei besonders starken Schwankungen oder einem frühen bzw. abrupten Beginn der Menopause steigt die Wahrscheinlichkeit für psychische Belastungen.
Gleichzeitig entscheiden psychosoziale Faktoren maßgeblich über die Vulnerabilität. Aktueller Lebensstress, biografische Traumata oder soziale Isolation können die Wirkungen der hormonellen Veränderungen verstärken. Auch die Persönlichkeitsstruktur ist relevant: Menschen mit hohem Perfektionismus oder ausgeprägtem Kontrollbedürfnis erleben die körperlichen Veränderungen oft als besonders belastend.
Die Wechseljahre fallen oft mit anderen Lebenskrisen zusammen. Jobverlust, Trennung oder die Pflege von Angehörigen können die ohnehin angespannte Situation zusätzlich belasten. Körperliche Erkrankungen, chronischer Schlafmangel oder Bewegungsmangel verschlechtern die Ausgangslage weiter und können einen Teufelskreis aus körperlicher und seelischer Belastung in Gang setzen.
Behandlungsmöglichkeiten: Ein individueller Ansatz
Bei ausgeprägten Beschwerden kann eine Hormonersatztherapie (HRT) erwogen werden. Eine HRT kann Stimmungsschwankungen reduzieren, die Schlafqualität verbessern und das allgemeine Wohlbefinden steigern. Gleichzeitig kann sie die Wirksamkeit einer begleitenden Psychotherapie unterstützen, da sich viele Patientinnen unter hormoneller Stabilisierung emotional ausgeglichener fühlen.8 Jedoch beinhaltet eine HRT nicht nur Vorteile, so dass Nutzen und Risiken gemeinsam mit der behandelnden Gynäkologin oder dem behandelnden Gynäkologen abzuwägen sind.
Eine professionelle psychotherapeutische Begleitung ist oft entscheidend für den Behandlungserfolg. Bewährt hat sich die kognitive Verhaltenstherapie, die Betroffenen hilft, negative Denkmuster zu erkennen und zu verändern. Aber auch psychodynamische Verfahren, wie etwa die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, können je nach Bedarfslage indiziert sein. Hier werden tiefgreifendere Themen, wie Prägungen aus der eigenen Kindheit und seelische Verletzungen, vornehmlich adressiert. Achtsamkeitsbasierte Therapieansätze reduzieren Stress und verbessern die Emotionsregulation.
Moderne Online-Therapieprogramme bieten niedrigschwellige, professionelle Hilfe und können traditionelle Therapieformen sinnvoll ergänzen. Sie ermöglichen flexible Behandlungszeiten, die sich an den Alltag der Betroffenen anpassen lassen.
Selbsthilfe-Strategien für den Alltag
Regelmäßige Bewegung wirkt nachweislich antidepressiv und hilft bei der Hormonregulation. Bereits 30 Minuten moderate Aktivität täglich können spürbare Verbesserungen bewirken.9 Eine ausgewogene Ernährung unterstützt die Neurotransmitter-Balance im Gehirn – Omega-3-reiche Lebensmittel liefern wichtige Bausteine für die Serotoninproduktion. Stressreduktion durch Meditation, Yoga oder Progressive Muskelentspannung hilft dem Nervensystem, zur Ruhe zu kommen. Ebenso wichtig ist der soziale Kontakt: Der Austausch mit anderen betroffenen Frauen kann enorm entlastend wirken und das Gefühl vermitteln, mit den Herausforderungen nicht allein zu sein.
Guter Schlaf ist in den Wechseljahren besonders wichtig, aber oft schwer zu erreichen. Eine kühle, dunkle Schlafumgebung kann Hitzewallungen reduzieren und erholsameren Schlaf fördern. Feste Schlafenszeiten helfen dem Körper, trotz hormoneller Schwankungen einen Rhythmus zu finden. Die Reduzierung der Bildschirmzeit vor dem Schlafen und das Entwickeln entspannender Rituale wie ein warmes Bad oder beruhigende Musik können den Übergang in den Schlaf erleichtern. Zudem lohnt es sich, den Konsum von koffein- oder teeinhaltigen Getränken zu überdenken und am Nachmittag auf Kräutertees oder entkoffeinierten Kaffee umzustellen.
Fazit: Wechseljahre ganzheitlich betrachten
Die Menopause ist mehr als das Ende der Fruchtbarkeit – sie ist eine umfassende körperliche und seelische Transformation. Das Verständnis für den Zusammenhang zwischen hormonellen Veränderungen und psychischer Gesundheit wächst stetig.
Die gute Nachricht: Die Wechseljahre sind ein vorübergehender Zustand. Der Körper lernt mit der Zeit, mit dem veränderten Hormonstatus umzugehen. Mit der richtigen Unterstützung und Behandlung lassen sich psychische, wie auch viele körperliche Beschwerden gut behandeln. Viele Frauen berichten, dass sie nach den Wechseljahren zu neuer Kraft und Lebensfreude finden. Die Phase der hormonellen Umstellung kann auch als Chance verstanden werden, das eigene Leben zu reflektieren und neue Prioritäten zu setzen.
Nehmen Sie Warnsignale ernst
Bei Fragen zu den Wechseljahren und ihren Auswirkungen auf die psychische Gesundheit wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihre Ärztin. Wenn depressive Verstimmungen länger als zwei Wochen anhalten oder den Alltag beeinträchtigen, sollten Sie professionelle Unterstützung suchen. Bei Suizidgedanken oder schweren Angstzuständen ist sofortige Hilfe erforderlich.
AG Hormone des Berufsverbands der Frauenärzte (BVF)., Mueck, A. Anwendungsempfehlungen zur Hormonsubstitution in Klimakterium und Postmenopause. Gynäkologische Endokrinologie 13, 270–273 (2015). https://doi.org/10.1007/s10304-015-0039-x
Deutsche Menopause Gesellschaft e.V. „ Was ist die Menopause? “. Zugegriffen 26. August 2025. https://www.menopause-gesellschaft.de/was-ist-die-menopause.
Alblooshi, Salama, Mark Taylor, und Neeraj Gill. „Does Menopause Elevate the Risk for Developing Depression and Anxiety? Results from a Systematic Review“. Australasian Psychiatry 31, Nr. 2 (24. März 2023): 165–73. https://doi.org/10.1177/10398562231165439.
Bell, Robin J. „Chronic Pain and Menopausal Symptoms“. Menopause 26, Nr. 7 (Juli 2019): 694–95. https://doi.org/10.1097/gme.0000000000001331.
Freeman, Ellen W., Mary D. Sammel, Hui Lin, und Deborah B. Nelson. „Associations of Hormones and Menopausal Status With Depressed Mood in Women With No History of Depression“. Archives of General Psychiatry 63, Nr. 4 (1. April 2006): 375. https://doi.org/10.1001/archpsyc.63.4.375.
Horst, Karen, Nicole Cirino, und Karen E. Adams. „Menopause and Mental Health“. Current Opinion in Obstetrics & Gynecology 37, Nr. 2 (25. Februar 2025): 102–10. https://doi.org/10.1097/gco.0000000000001014.
Stute, Petra. „‚Brain fog‘ in den Wechseljahren“. Gynäkologische Endokrinologie 21, Nr. 1 (2. Januar 2023): 62–63. https://doi.org/10.1007/s10304-022-00488-w.
Verhoeven, Josine E., Laura K.M. Han, Bianca A. Lever-van Milligen, Mandy X. Hu, Dóra Révész, Adriaan W. Hoogendoorn, Neeltje M. Batelaan, u. a. „Antidepressants or Running Therapy: Comparing Effects on Mental and Physical Health in Patients with Depression and Anxiety Disorders“. Journal of Affective Disorders 329 (Mai 2023): 19–29. https://doi.org/10.1016/j.jad.2023.02.064.
Diesen Artikel teilen:
Weitere Impulse für Ihre mentale Gesundheit finden Sie auf unserem Instagram-Kanal:
Verwandte Artikel zu diesem Thema

Depressionen – Du bist nicht allein
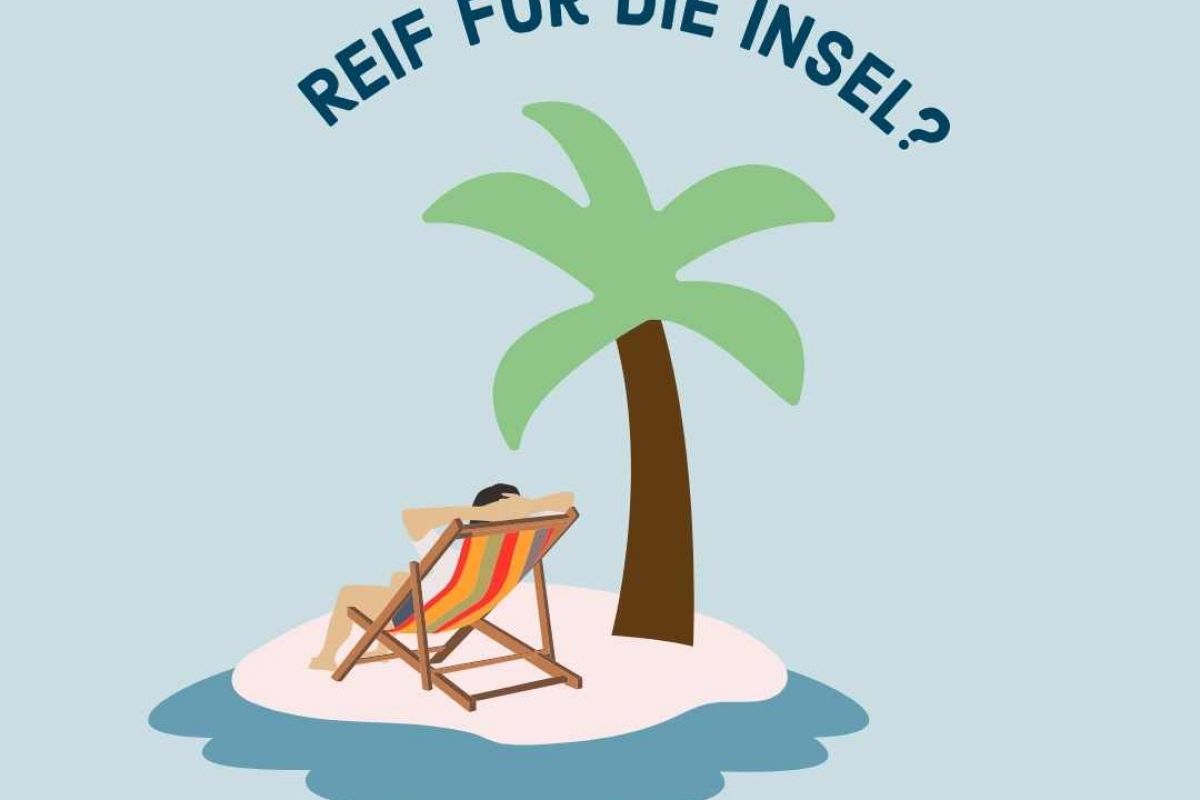
Reif für die Insel?

Unser Stresshormon Cortisol
Kostenfreie psychologische Soforthilfe auf Rezept
Unsere psychologischen Online-Therapieprogramme bei Depression und Angst sind als Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) zertifiziert und somit kostenfrei auf Rezept für Sie erhältlich. Lassen Sie sich Novego einfach von Ihrem Arzt oder Psychotherapeuten verordnen und starten Sie ohne Wartezeit und ohne Kosten mit Ihrer Online-Therapie.
Dies ist eine unabhängige Patienteninformation mit dem Ziel, unseren Nutzern bedarfsorientierte und qualitativ hochwertige Inhalte zu präsentieren, die auch ohne medizinisches Fachwissen verständlich sind. Es wird keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. In allen Belangen kann und sollte der behandelnde Arzt konsultiert werden. Diese Patienteninformation kann keine ärztliche Beratung, Diagnostik oder Therapie ersetzen.

